Als Bodengefüge
oder Bodenstruktur wird
die räumliche Anordnung der unregelmäßig geformten
festen mineralischen und organischen Bodenbestandteile bezeichnet,
durch die das ganze Bodenvolumen in das Volumen der festen
Bodensubstanz, das sogenannte Substanzvolumen
und in das Porenvolumen
differenziert wird.
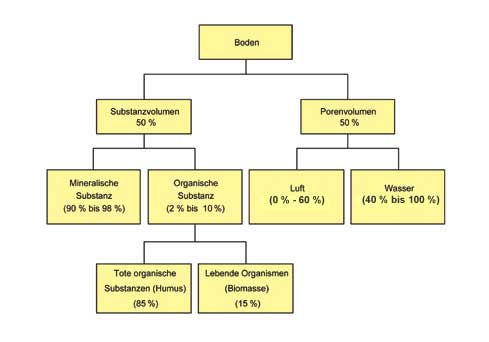 |
| Substanzvolumen und Porenvolumen des
Bodens |
Abhängig von der Bodenart, dem Gehalt
an organischer Substanz, der Tätigkeit der Bodenorganismen
(z.B. Bioturbation) sowie von Art und Grad der Zusammenlagerung
von mineralischen und organischen Boden-komponenten (s. Gefüge-Formen
und ihre Entstehung) zeigen die verschiedenen Böden sehr
unterschiedliche Aufteilungen des Bodenvolumens.
Von dieser Aufteilung des Bodenvolumens
sind der Wasser-, Luft-, Wärme- und Nährstoffhaushalt,
die Durchwurzelbarkeit und die Bearbeitbarkeit sowie die Verlagerungsprozesse
bei der Bodengenese abhängig (s. Bodenentwicklung
und Bodeneigenschaften).
Weitere Informationen:
| Literatur: |
| AG
BODEN (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. Hannover |
| BERGSTEDT, C./ DIETRICH, V./LIEBERS,
K.(Hg.). (1998): Boden. Naturwissenschaften Biologie-Chemie-Physik.
Berlin:Volk und Wissen |
| ENSSLIN, W./ KRAHN, R./ SKUPIN,
S. (2000): Böden untersuchen. Wiebelsheim: Quelle
& Mayer |
| GISI, U. et al. (1997): Bodenökologie.
Stuttgart - New York: Thieme |
| HINTERMAIER-ERHARD, G./ ZECH,
W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:
Enke. |
| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde
in Stichworten.Berlin; Stuttgart: Borntraeger |
Substanzvolumen
Als Substanzvolumen
des Bodens (SV) wird das Volumen aller festen Bodenbestandteile
(= Bodenmatrix) bezeichnet. Es ergibt sich aus der Differenz
zwischen Bodenvolumen (BV) und Porenvolumen (PV): SV = BV
- PV.
Je nach Qualität der Festsubstanz
des Bodenkörpers unterscheidet man zwischen mineralischer
und organischer Bodensubstanz, die aber in der Regel in der
Bodenmatrix in gemischter Form vorliegt.
Porenvolumen
Als Porenvolumen
(PV) wird der Anteil der mit Luft bzw. Gas und/ oder Wasser
bzw. Bodenlösung gefüllten Poren (= Bodenhohlräume)
am Bodenkörper bezeichnet. Es ergibt sich aus der Differenz
zwischen Bodenvolumen (BV) und Substanzvolumen (SV): PV =
BV - SV.
Das Porenvolumen wird durch Poren unterschiedlicher
Größe und Gestalt differenziert:
| • |
Grobporen: mittlerer Durchmesser
> 10 µm, Sickerwasser führend, nach Abzug
des Sickerwassers mit Luft gefüllt; |
| • |
Mittelporen: Ø
10 - 0,2 µm, verfügbares Haltwasser haltend,
bei Austrocknung mit Luft gefüllt; |
| • |
Feinporen: Ø <
0,2 µm, nicht verfügbares Haftwasser haltend,
nur bei starker Austrocknung mit Luft gefüllt. |
Abhängig von der Größe
der Poren enthält das Porenvolumen unterschiedliche Anteile
an gasförmigen Bestandteilen (Bodenluft) und flüssigen
Bestandteilen (Bodenwasser bzw. wässrige Bodenlösung).
Allgemein nehmen das Porenvolumen und der Anteil der wasserführenden
Feinporen mit abnehmender Korngröße der festen
Bodensubstanz zu.
| Literatur: |
| BERGSTEDT, C./ DIETRICH, V./LIEBERS,
K.(Hg.). (1998): Boden. Naturwissenschaften Biologie-Chemie-Physik.
Berlin:Volk und Wissen |
| HINTERMAIER-ERHARD, G./ZECH,
W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:
Enke. |
| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde
in Stichworten.Berlin; Stuttgart: Borntraeger |
Gefüge-Formen
und ihre Entstehung
Nach der räumlichen Anordnung und
Dichte der Teilchen werden grundsätzlich 4 Gefüge-Formen
unterschieden:
| 1. |
Elementar-
oder Einzelkorngefüge: die festen Mineral-
und Humuspartikel liegen isoliert nebeneinander, z.B.
loser Sand; |
| 2. |
Kohärent-
oder Hüllengefüge: die Bodenteilchen
bilden ein dicht zusammenhängendes (kohärentes)
Gefüge dichtester Packung, z.B. größere
Mineralkörner mit dichten Umhüllungen etwa von
Calciumcarbonat (CaCO3), kolloider
Kieselsäure, Huminstoffe, Tonsubstanzen oder andere
Materialien; |
| 3. |
Aggregat-
oder Aufbaugefüge: die mineralischen und organischen
Bodenteilchen bilden durch lockere Aneinanderlagerung
und Kopplung Aggregate unterschiedlicher Größe
und Form, z.B. Krümel (Ø 1-10 mm) oder Bröckel
(Ø > 10 mm); |
| 4. |
Segregat-
oder Absonderungsgefüge: die überwiegend
feinkörnigen mineralischen Bodenpartikel bilden kleinere
oder größere Absonderungsformen (Segregate),
vor allem infolge von Austrocknungs- und Schrumpfungsprozessen,
in Form von Polyedern, Prismen, Säulen oder Platten. |
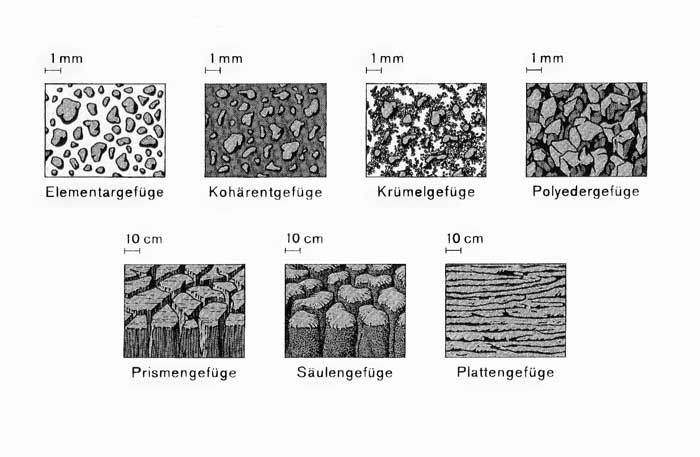 |
Schema der wichtigsten Gefüge-Formen
verändert nach: SCHROEDER, D. (1992), S. 59 |
Während die Gefüge-Formen des
Makrogefüges mit den bloßen Augen zu erkennen sind,
lassen sich Mikrogefüge-Strukturen nur mit Hilfe von
Bodendünnschliffen unter dem Mikroskop analysieren.
Ein optimales Verhältnis
von Substanzvolumen und Porenvolumen mit entsprechend optimaler
Porenverteilung ist lediglich beim Aggregatgefüge und
hier insbesondere beim Krümelgefüge gegeben.
An der Entstehung der Gefüge-Formen
sind unterschiedliche Substanzen beteiligt:
| • |
Mineralische und organische Bodenkolloide, |
| • |
Organismen des Edaphons, |
| • |
Wurzeln der höheren Pflanzen
und |
| • |
Calciumcarbonat (CaCO3). |
Zusätzlich müssen aggregierende
(zusammenlagernde) und segregierende (zerteilende) Kräfte
wirksam werden. Aggregierende Kräfte sind etwa Kohäsions-
und Adhäsionskräfte; segregierende Kräfte sind
insbesondere Dehydratationskräfte (bei Schrumpfung von
gequollenen Kolloiden bei Wasserverlust) und Druckkräfte
beim Gefrieren von Wasser.
| Literatur: |
| AG BODEN (1994): Bodenkundliche
Kartieranleitung. Hannover |
| BERGSTEDT, C./ DIETRICH, V./LIEBERS,
K.(Hg.). (1998): Boden. Naturwissenschaften Biologie-Chemie-Physik.
Berlin:Volk und Wissen |
| ENSSLIN, W./KRAHN, R./SKUPIN,
S. (2000): Böden untersuchen. Wiebelsheim: Quelle
& Mayer |
| GISI, U. et al. (1997): Bodenökologie.
Stuttgart - New York: Thieme |
| HINTERMAIER-ERHARD, G./ZECH,
W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:
Enke. |
| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde
in Stichworten.Berlin; Stuttgart: Borntraeger |
|