Die der Verwitterung
ausgesetzten Minerale werden
je nach Intensität und Dauer der ablaufenden Verwitterungsprozesse
entweder unter Erhalt der Grundstruktur nur mehr oder weniger
stark abgebaut oder aber vollständig in ionare und kolloide
Zerfallsprodukte aufgelöst. Die Abbaustufen können
derart stark verändert sein, das
„sekundäre“ Neubildungen entstehen.
Die Synthese derartiger Minerale ist aber auch aus den ionaren
und kolloiden Zerfallsprodukten der Verwitterungsprozesse
möglich.
Zu den wichtigsten Mineralneubildungen
zählen Tonminerale sowie Oxide
und Hydroxide.
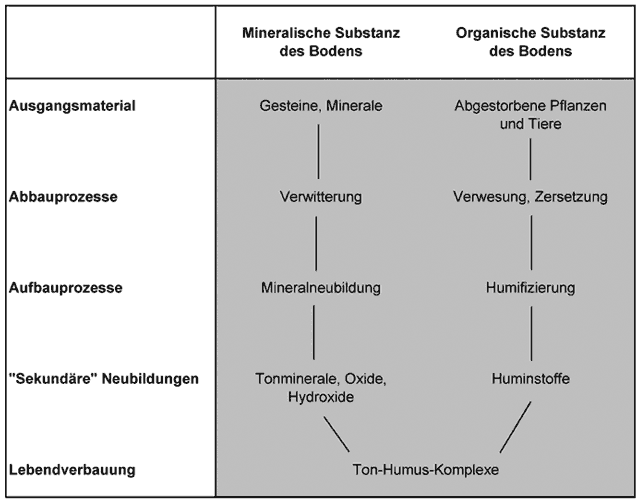 |
| Abbau- und Aufbauprozesse
der Bodenbildung (Abb. verändert nach: MAYER 1996,
S. 13) |
Weitere Informationen:
Literatur:
BAUER, J. et al. (2002): Physische
Geographie kompakt. Heidelberg, Berlin: Spektrum.
BLUME, H.-P./ FELIX-HENNINGSEN, P./ FISCHER, R./ FREDE, H.-G./
HORN, R./ STAHR, K. (1996): Handbuch der Bodenkunde. Landsberg/Lech:
ecomed.
HINTERMAIER-ERHARD, G./ ZECH, W. (1997): Wörterbuch der
Bodenkunde. Stuttgart: Enke
KUNTZE, H./ ROESCHMANN, G./ SCHWERTFEGER, G. (1994): Bodenkunde.
Stuttgart. Ulmer
LEXIKON DER GEOWISSENSCHAFTEN IN SECHS BÄNDEN (2000):
Erster Band A bis Edi. Heidelberg, Berlin: Spektrum.
NEEF, E. (1977): Das Gesicht der Erde. Thun, Frankfurt/M:
Harri Deutsch.
SCHEFFER, F./ SCHACHTSCHABEL, P. (2002): Lehrbuch der Bodenkunde.
Stuttgart: Spektrum.
SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde in Stichworten. Stuttgart:
Borntraeger.
SCHROEDER, D. (2000): Böden der Erde: Entstehung, Verbreitung,
Produktivität, Schädigung und Schutz. – Geographie
und Schule, 22, Heft 126: S. 9-18.
Tonminerale
Tonminerale sind Schichtsilikate
mit einem mittleren Teilchendurchmesser von < 2 µm.
Sie sind die Hauptbestandteile der Tone, kommen aber auch
häufig in Schluffen vor.
Tonminerale entstehen sowohl durch die Umwandlung primärer
Minerale (wie z.B. Glimmer) als auch durch die Synthese ionarer
und kolloidaler Verwitterungsprodukte.
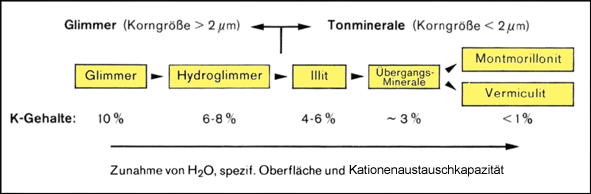 |
Schema der Entstehung von Dreischicht-Tonmineralen
aus Glimmern
(Abb. verändert nach: SCHROEDER 1992, S. 22) |
Tonminerale besitzen große spezifische
Oberflächen, haben die Fähigkeit der reversiblen
An- und Einlagerung von Wassermolekülen, sind in der
Lage zu quellen und zu schrumpfen, sind der Grund für
die Plastizität der Tone und verfügen über
die Eigenschaft, Ionen in austauschbarer Form zu adsorbieren
(s. Ionenaustausch). Gemeinsam
mit der organischen Substanz bedingen sie die Fähigkeit
der Böden zur Wasserbindung,
Gefügebildung und Nährstoffadsorption.
Tonminerale werden eingeteilt in Zweischicht-
und Dreischichtminerale, je nachdem, ob die Oktaederschicht
im Kristallgitter mit einer oder zwei Tetraederschicht(en)
verbunden ist. Zu den Zweischicht-Tonmineralen gehören
beispielsweise Kaolinit und Halloysit, zu den Dreischicht-Tonmineralen
zählen u.a. Illit und Montmorillonit.
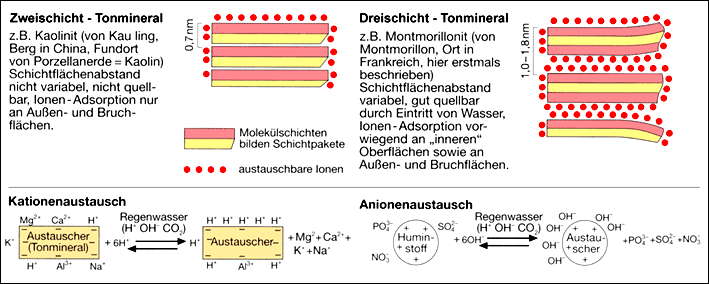 |
| Zweischicht- und Dreischicht-Tonminerale
(Abb. verändert nach: BAUER et al. 2002, S. 133) |
Oxide
und Hydroxide
Die Oxide und Hydroxide gehen aus der
Oxidationsverwitterung hervor. Als amorphe, parakristalline
oder gut kristallisierte Verbindungen können sie vorliegen
als:
- Umhüllungen anderer Minerale,
- Bindemittel von Mineral- und Bodenaggregaten,
- kleinere und größere Konkretionen, Einzelminerale.
Oxide und Hydroxide sind an wesentlichen
Prozessen der Bodenentwicklung beteiligt und verursachen zum
Teil (Fe-/Mn-Oxide und –Hydroxide) die charakteristische
Färbung des Mineralkörpers verschiedener Bodentypen
(z.B. der rötlichen Ferrallite der Tropenzone).
|